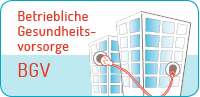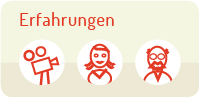Im antiken Griechenland erkannte man in einer allseitigen „Erziehung“ (Paideïa) jene gesellschaftliche Aufgabe, die eine künstlerische, intellektuelle und körperliche Ertüchtigung zu umfassen hatte. Bildung diente dort dem Ideal der vollwertigen Persönlichkeit als griechischer Bürger. Nicht zufällig liegt der Ursprung der abendländischen Medizin – verkörpert durch Hippokrates – in der Anleitung zu einem Leben mit Maß (Diätetik). Im christlichen Abendland wiederum war man einer pastoralen Logik verpflichtet, welche die Persönlichkeitsentwicklung in Gehorsam, Selbstvergessenheit und Kasteiung zu verankern suchte (Askese).
Die griechische Antike kannte sowohl einen Körperkult wie auch einen Asklepios, den Gott der Heilkunst, hingegen das christliche Abendland einen – „rein körperlich“ leidenden – Jesus. Im mittelalterlichen Persien sieht die Entwicklung ganz anders aus. Schon im 10. Jahrhundert verlangt der Arzt Ibn Zakaria al-Razi (Razes) nach einer auf Experimenten beruhenden Medizin. Der Entdecker der Psychosomatik, Ibn Sina (Avicenna), verfasst das damalige Standardwerk seiner Zeit, einen „Kanon der Medizin“, der so ziemlich alles enthält: von den allgemeinen Prinzipien über Krankheitsdiagnosen bis zu chirurgischen Eingriffen und der Produktion von Heilmitteln.
Deren Bücher werden auch in Europa gelesen. Die Fortschritte überschlagen sich alsbald: Vesalius seziert im 16. Jahrhundert öffentlich Leichen und studiert die Anatomie. William Harvey weist im 17. Jahrhundert den Blutkreislauf und die Herzpumpenfunktion nach. Mithilfe seines Mikroskops beschreibt Felice Fontana bereits im 18. Jahrhundert exakt die Axone der Nerven. Und Emanuel Swedenborg erkennt, dass die Großhirnrinde eine funktionelle Gliederung ihrer Areale besitzt. Der Seelenbegriff wird immer obsoleter – der Blick auf den Menschen insgesamt nüchterner.
Kein Wunder, dass der erste philosophische Versuch, sich von der Knute körperfeindlicher, christlicher und irrationaler Ideen zu befreien, vom wachsenden medizinischen Fachwissen geradezu angetrieben worden ist. Heute nennt man diese Philosophie den mechanischen Materialismus. 1748 erscheint ihr Paradewerk „L'homme machine“ (Der Mensch – die Maschine) von Julien Offray de La Mettrie, in dem er sagt: „Zerreißt die Ketten eurer Vorurteile; bewaffnet euch mit der Fackel der Erfahrung“. Mehr und mehr rücken Leib und Seele zusammen. Interessant ist insbesondere der Fall von Phineas Gage im 19. Jahrhundert, des amerikanischen Vorarbeiters einer Eisenbahngesellschaft, dem eine Eisenstange Auge und Schädeldecke (präfrontalen Cortex) durchbohrt hat, der aber binnen Tagen seine geistigen Funktionen allesamt wiedererlangt hat, abgesehen von einer schweren Persönlichkeitsveränderung (Frontalhirnsyndrom).
Seither hat sich ein gereifter philosophischer Realismus durchgesetzt, und es besteht kein Zweifel mehr an der innigen Verbindung zwischen Körperlichkeit und Persönlichkeit. Unzählige naturwissenschaftliche Studien belegen: der Mensch stellt eine bio-psycho-soziale Einheit dar. Um diese Sphären „zusammen“ zu denken, braucht es – Denken. Sachbezogene Reflexion ermöglicht uns, den Gesichtskreis zu erweitern, Zustände als Vorgänge zu betrachten und sie in ihren Wechselwirkungen und Zusammenhängen zu verstehen. Als Louis Pasteur 1860 die sogenannte Urzeugung widerlegt und Gärungen auf Mikroorganismen zurückführt, lässt er ähnliche Töne anklingen: „Die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles.“
Das christliche Leib-Seele-Problem hat sich, wie gesagt, als Scheinfrage aufgelöst. Die kulturelle Abwertung des Körperlichen indessen hat sich in der Praxis erhalten. Amerikanische Gesundheitswissenschaftler wie beispielsweise Stuckler und Basu weisen nicht grundlos darauf hin, dass die Postleitzahl „einer der wichtigsten Faktoren für die Berechnung der Lebenserwartung“ geworden ist. Gesellschaftsschichten, die von Armut betroffen sind, werden schneller alt und leichter krank. Eine medizinisch fundierte Erklärung des „sozialen Gradienten“, dessen Hauptursache im psychosozialen Stress aufgrund von Rangunterschieden liegt, ist heutzutage aus der Prävention nicht mehr wegzudenken.
Die institutionelle Medizin fasst einerseits unter der Rubrik „Risikofaktoren“ beliebig viele Dinge auf beliebige Weise zusammen und tappt insofern ein wenig im Dunkeln. In der Umgehung der für sie unlösbaren Milieufrage macht sie andererseits eine Reihe von vorbeugenden Gesundheitsmaßnahmen plötzlich zur Privatsache und erhöht damit noch den psychosozialen Stress – ganz im Gegensatz zur demokratisierten Medizin einer HRV-Messung und ihres personalisierten Analyse-Coachings. Selbige ist kein so stumpfes Werkzeug, wohlgemerkt, weil selbst niedergelassene Ärzte aus finanziellem Druck heraus (Krankenschein-Sachzwang) kaum mehr als zehn Minuten pro Patient aufwenden können.
In der HRV gibt es keine nur punktuellen Untersuchungen mit punktuellen Ergebnissen, keine kryptischen, kaum laientauglichen Befunde und auch keine zusätzlichen Kosten. Die HRV-Messung berücksichtigt insgesamt über 50 Gesundheitsparameter. Neben den durchschnittlichen Herzraten, der Anzahl der Herzschläge in 24 Stunden, dem Verhältnis von Atmung zu Herzschlag usw. werden essenzielle Faktoren wie Schlafqualität, Regenerationsfähigkeit, geistige Vitalität im Verhältnis zur körperlichen usw. gemessen. In ihrer Zusammenschau liefern sie ein detailliertes, gesichertes und für alle nachvollziehbares Bild zu den bio-psycho-sozialen Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken eines Menschen (SWOT-Analyse). So kann man gesundheitsgefährdende Tendenzen frühzeitig erkennen und ihnen wirksam entgegensteuern. Die Therapieerfolge jedweder Intervention sind obendrein validierbar (HRV-Folgemessung). Nicht zuletzt ist ein ressourcenorientierter Zugang in Form eines ausführlichen Gesprächs samt Beratung um einiges persönlicher, nutzbringender – und menschlicher.